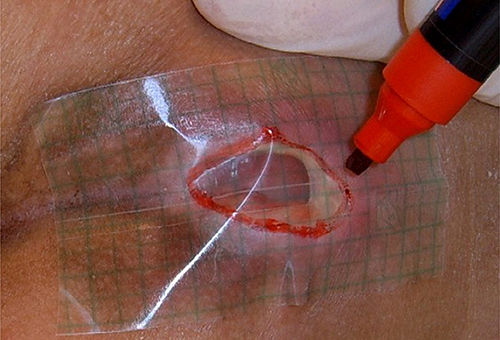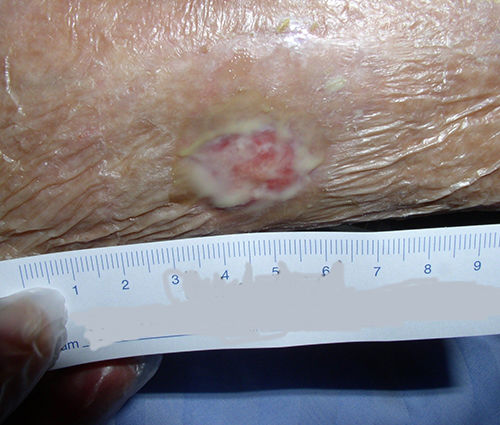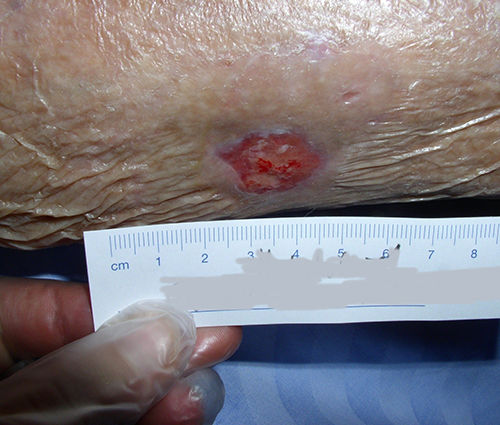Als Grundlage der koordinierten Therapie weist die Wunddokumentation geleistete Maßnahmen nach und macht den Heilungsverlauf nachvollziehbar. Auf dieser Basis ermöglicht sie eine Einschätzung des weiteren Heilungsverlaufs. So können Problematiken und Hindernisse rasch erfasst und behoben werden. Die Wunddokumentation gewährleistet gleichermaßen Rechtssicherheit, Qualitätssicherung und ermöglicht das koordinierte Vorgehen zur einheitlichen Wundbehandlung durch alle an der Versorgung Beteiligten.
Merke: „Was nicht dokumentiert ist, gilt als nicht gemacht!“
Um den Anforderungen der Wunddokumentation gerecht zu werden, sind weiterführende Fachkenntnisse eine grundlegende Voraussetzung. Hierzu gehören Kenntnisse über:
- Pathophysiologie von Wunden und deren Grunderkrankungen
- Anatomie und Physiologie der Haut
- Phasen und Stadien der Wundheilung
- Aktuellen Stand der Wissenschaft im Bereich Wundversorgung
- Sachgerechtes Dokumentieren.
Die Wunddokumentation kann sowohl auf klassischen Papierformularen als auch elektronisch, d. h. EDV-gestützt erfolgen. Wunddokumentationsbögen und EDV-Systeme sollten gut verständlich und einfach durch Ankreuzen oder Anklicken zu bearbeiten sein. Freitextfelder können zur Folge haben, dass Eintragungen zu „Romanen“ anwachsen. Subjektive Einschätzungen wie „Wunde suppt“, „sieht gut aus“, „o. B.“ werden durch anzukreuzende, vorformulierte und allgemein verständliche Definitionen vermieden. Liegen auffällige Besonderheiten vor, die durch die angegebenen Felder nicht vordefiniert sind, können diese beispielsweise in einem Feld „Sonstiges“ oder im Pflegebericht eingetragen werden. Dies beugt möglichen Verständnisproblemen durch variierende Sprache, Schriftbild und Ausdruck vor. Zudem sind Veränderungen zeitnah auf einen Blick zu erkennen. Dabei ist zu beachten, dass pro Bogen nur eine Wunde dokumentiert wird. Nachfolgende Inhalte orientieren sich an der ersten Aktualisierung (2015) des DNQP Expertenstandards „Pflege von Menschen mit chronischen Wunden“.